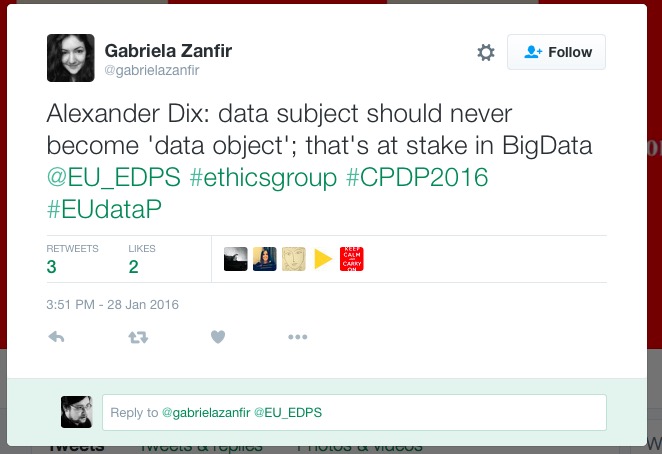/*******
 Im Sommer fragte mich der großartige Christoph Engemann, ob ich nicht die schönsten Tage im Jahr damit zubringen wolle, einen ellenlangen Text für einen Reader zum Internet of Things zu verfassen. Da man zu Christoph Engemann nie nein sagt, habe ich natürlich zugesagt. Das Buch: „Internet der Dinge – Über smarte Objekte, intelligente Umgebungen und die technische Durchdringung der Welt“ (Werbelink) ist jetzt raus und sehr empfehlenswert. Es finden sich unter anderem Texte von Mercedes Bunz, Linus Neumann und Sebastian Gießmann darin. Mein Text versucht anhand von „Game of Thrones“ die wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen des Internet of Things zu erklären. Und weil Linus das auch gemacht hat, stell ich hier auch mal meinen Text zur Verfügung. Quasi als Werbung für das Buch.
Im Sommer fragte mich der großartige Christoph Engemann, ob ich nicht die schönsten Tage im Jahr damit zubringen wolle, einen ellenlangen Text für einen Reader zum Internet of Things zu verfassen. Da man zu Christoph Engemann nie nein sagt, habe ich natürlich zugesagt. Das Buch: „Internet der Dinge – Über smarte Objekte, intelligente Umgebungen und die technische Durchdringung der Welt“ (Werbelink) ist jetzt raus und sehr empfehlenswert. Es finden sich unter anderem Texte von Mercedes Bunz, Linus Neumann und Sebastian Gießmann darin. Mein Text versucht anhand von „Game of Thrones“ die wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen des Internet of Things zu erklären. Und weil Linus das auch gemacht hat, stell ich hier auch mal meinen Text zur Verfügung. Quasi als Werbung für das Buch.
********/
Vorrede
Mit Friedrich Kittler hielt eine Neuerung innerhalb der Geisteswissenschaften Einzug, die wohl sein wichtigstes Vermächtnis bleibt: Das Interesse und die deutliche Einbeziehung von technischem Sachverstand in eine Disziplin, die bislang mit ihrer Technikferne und ihrer abstinenten und kritischen Haltung gegenüber technischen Neuerungen geradezu kokettierte. Dies war ein wichtiger Schritt, der die Medienwissenschaften in der Tiefe, wie sie heute praktiziert wird, erst ermöglichte. Natürlich würde heute niemand mehr abstreiten, dass technisches Design sowie die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Apparatur in medientheoretischen Überlegungen mit einfließen müssen.
Mit dem kittlerschen Diktum hat sich die Medienwissenschaft aber auch in eine Sackgasse begeben. Die Anschauung des »Geräts« reicht lange nicht mehr aus, um die Entwicklungen der letzten 15 Jahre auch nur annähernd adäquat beschreiben zu können. Das Gerät wurde vernetzt und vor allem in dieser Vernetzung hat es seine ungeheuer weltverändernde Kraft entwickelt, der wir heute gegenüberstehen. Kulturelle Praktiken und soziale Zusammenhänge, historische Konstellationen und die Betrachtung technischer Artefakte allein können den heutigen Stand der Medien nicht mehr erfassen. Sie erklären nicht die Größe von Google oder den Erfolg von Facebook. Sie verstehen die Machtspiele des Silicon Valley nicht und sind nicht kompetent im Erklären der Machtstrukturen.
Diese Kompetenz wird stattdessen den Wirtschaftswissenschaften zugeschrieben und das mit einem gewissen Recht. Während sich die Medienwissenschaften dem Gerät zuwendeten, hatten die Wirtschaftswissenschaften zunehmend die Transaktion und die Distribution von Information zu ihrem Gegenstand. Zusätzlich zwangen sogenannte »Externe Effekte«, die Wirtschaftswissenschaft immer wieder sich von ihrem ureigensten Thema – dem Markt – zu lösen und die Mechanik von Vernetzungszusammenhängen zu verstehen. So sammelten sich nach und nach Theorien über die Mechanik von zirkulierenden Zeichen in komplexen sozialen Gefügen, die – so meine Überzeugung – auch außerhalb der Wirtschaftswissenschaften ihren Nutzen haben können.
Statt sich also nur im Kleinklein technischer Details zu verlieren und historische Zusammenhänge zu suchen, wo doch gerade Neues entsteht, sollten die Medienwissenschaften prüfen, wie Theorien um »Disruption«, »Netzwerkeffekte« und »Transaktionskosten« ihnen helfen können, die aktuellen Medienformationen zu deuten.
Doch auch die Wirtschaftswissenschaften alleine tragen nur bis zu einem gewissen Punkt. War der Computer noch mit Müh und Not (auch) als Medium zu begreifen, wird es beim kommenden Internet of Things noch enger. Wenn Dinge durch ihre Ausstattung mit Mikrochips anfangen »mediale Eigenschaften« zu implementieren, werden sie nicht zu Medien im klassischen Sinne. Sie sind weit mehr, als die menschlichen Sinnesorgane erweiternden Prothesen, wie McLuhan sie noch sah. Die vernetzten Dinge leihen ihre Sinnesorgane nicht mehr in erster Linie dem Menschen, sondern zunehmend einander. Die Dynamik des dabei entstehenden Netzes einander zuhörender, kommunizierender, regulierender und einander kontrollierender Dinge, ist auch für die anthropozentrische Wirtschaftswissenschaft kaum mehr zugänglich.
Es wird also einerseits Zeit, sich im Werkzeugkasten der Wirtschaftswissenschaften zu bedienen. Das geht auch, ohne alle ihre Prämissen zu signieren. Andererseits soll das nicht ohne Rückgriff auf aktuelle sozialwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Theorien geschehen. Zu zeigen, wie wunderbar sich diese ergänzen – dafür gibt die Debatte um das Internet of Things hier Anlass.
1. Das Spiel um die Netzwerkeffekte
»You know nothing, Jon Snow«, ist der Satz, den Ygritte dem »Bastard« und Mitglied der »Nights Watch« Jon Snow immer wieder zuruft. Wir befinden uns bei Game of Thrones (Buch: Song Of Ice and Fire), jener populären Buch- und später Fernsehserie, die ihre Fans in Atem hält. Game of Thrones spielt in einem leicht Fantasy-haften Parallelmittelalter. Game of Thrones ist nur oberflächlich gesehen eine Fantasy-Saga. In Wirklichkeit sind trotz Magie, Drachen und Riesen die Machtspiele und politischen Verstrickungen der Menschen die entscheidenden Treiber der Handlung.
Das Setting ist wie folgt: Die sieben Adelshäuser auf dem Kontinent Westeros befinden sich im fortwährenden Konflikt um den eisernen Thron. Dieser wird mal als Intrige, zeitweiser Koalition, Verrat oder offenem Krieg ausgetragen. Jede der Familien hat, für sich genommen aus rein subjektiver Perspektive, einen gewissen Anspruch auf den Thron – oder glaubt zumindest, einen zu haben. Die sich in vielen nebeneinander verlaufenden Strängen verwickelnde
Handlung bringt komplexe politische Situationen hervor, die regelmäßig in spektakulären Showdowns zu unerwarteten Wendungen führen.
Trotz des erratischen Settings ist diese Erzählung auch gerade deswegen so populär, weil sie mit gelernten narrativen Strukturen bricht. In dem Handlungsgeflecht voller Eitelkeit, Hinterlist und politischem Verrat fallen die Protagonisten sinnbildlich wie die Fliegen. Tragende Figuren, die über viele Episoden mühsam aufgebaut wurden, werden mit der Leichtigkeit eines Fingerstreichs aus der Handlung befördert. Gerade diejenigen, die sich mit ihrer Ritterlichkeit und Reinherzigkeit unsere Sympathien erspielen, sind auch diejenigen, die schnell in den Hinterhalt gelockt und getötet werden.
Jon Snow ist so einer dieser ritterlichen Charaktere. Als unehelicher Sohn des Hauses Stark hat er einen relativ unterprivilegierten Status und bewacht als Ritter der »Nights Watch« die nördliche Mauer aus Eis, die Westeros vor den Gefahren aus der vereisten Welt jenseits der Mauer beschützen soll. »You know nothing« kann also als Mahnung verstanden werden, als ein Verweis auf die Naivität desjenigen, der die Regeln des Spiels nicht versteht, das er spielen soll.
In einer ähnlichen Situation stehen wir heute. Das Spiel hat sich durch die Digitalisierung und das Internet radikal verändert. Geschäftsmodelle, Lebenskonzepte, politische und soziale Gewissheiten wirken immer seltener tragfähig. Es findet nicht nur eine Anpassung der einen oder anderen Spielregel statt, das gesamte Spiel ist ein anderes, und so führt die Interpretation aktueller Ereignisse unter den Prämissen des alten Spiels regelmäßig zu Missverständnissen.
Als Facebook 2012 Instagram für insgesamt eine Milliarde Dollar kaufte, waren selbst Silicon-Valley-Kenner geschockt. Eine solche Unternehmensbewertung für ein Unternehmen, das erst zwei Jahre alt war und nur 13 Mitarbeiter hatte, war ein Dammbruch. Natürlich wurde heiß über eine neue Technologie-Blase diskutiert, die sich vermeintlich aufgetan hätte.
Rückblickend aber erscheint die Milliarde für Instagram beinahe mickrig, seitdem Facebook nur wenige Monate später WhatsApp für insgesamt 19 Milliarden Dollar gekauft hat. WhatsApp war zum Zeitpunkt des Kaufs noch kleiner als Instagram und hatte noch weniger Mitarbeiter. Hinzu kommt, dass WhatsApp von seinem technologischen Ansatz her viel trivialer ist als ein richtiges Social Network wie Instagram.
Unter den herkömmlichen ökonomischen Prämissen ist so eine Investition kaum zu rechtfertigen. Was also hat den als wirtschaftlich kühl agierend bekannten Facebook-CEO Mark Zuckerberg dazu getrieben, in kürzester Zeit so viel Geld für zwei vergleichsweise junge und kleine Start-Ups auszugeben? Es war viel davon die Rede, dass es Facebook vermutlich um die Daten gehe und es wurde ausgerechnet, was das Unternehmen faktisch pro User auf den Tisch gelegt hatte. Andere vermuteten eine selten kostbare Belegschaft, die sie sich einverleiben wollten.
»You know nothing« würde Ygritte ihnen zurufen. Sie wissen nicht, wie das Spiel funktioniert, sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Mark Zuckerberg aber weiß es: es geht nur um die Netzwerkeffekte. Sie sind schlussendlich einer der Gründe, warum Facebook so erfolgreich ist und eben diese Netzwerkeffekte, sind auch der Grund, warum Zuckerberg trotzdem nicht gut schlafen kann.
Netzwerkeffekte sind so genannte positive Rückkopplungen, die auf das Wachstum eines Netzwerkes wirken. Der allererste Telefonnutzer hatte nicht viel Freude an seinem Gerät. Ein Telefon stiftet erst Nutzen, wenn es mit anderen Telefonen verbunden wird. Dieser Nutzen steigt mit jedem einzelnen Teilnehmer, der an das Netzwerk angeschlossen wird.
Die Netzwerkeffekte gelten selbstverständlich auch für alle andere Arten von interaktiven Kommunikationssystemen: für Faxmaschinen, Telefonsysteme oder Netzwerkprotokolle, aber auch für solche Dinge wie Standards in der Computertechnologie. Überall dort, wo unterschiedliche Teilnehmer interagieren und dies auf einer standardisierten Grundlage tun, kommen die Netzwerkeffekte zum Tragen. Das Neue an der Situation von Facebook und anderen Plattformen sind also gar nicht die Netzwerkeffekte. Die Netzwerkeffekte kommen nur heute stärker zum Tragen, denn etwas hatte sie bis jetzt gefesselt. Neben den positiven Rückkopplungen, die alle Tendenzen immer nur verstärken, gibt es auch solche, die alle Tendenzen immer schwächen. Eine solche negative Rückkopplung sind die Kosten, die Vernetzung produziert. Mit Kosten sind nicht nur Kosten gemeint, die tatsächlich Geld kosten, sondern es meint alle Kosten: jeden zusätzlichen Aufwand, jede extra Anstrengung, jede zusätzliche Zeit, aber vor allem auch jede zusätzliche Unsicherheit, die ich in Kauf nehmen muss, um z.B. zu kommunizieren. Diese Kosten zur Kommunikation sind es, die die Netzwerkeffekte in ihrem Wirken bislang immer gebremst haben. Und diese Kosten brechen durch das Internet und die Digitalisierung in einem größeren Maßstab weg.
Der erste Kommunikationskostenfaktor der wegfiel, waren die Kosten für die Überwindung von Entfernung. Noch bei Telefonbedingungen spielte Entfernung eine große Rolle. Unterschiedliche regionale, später nationale Telefonnetze mussten überbrückt werden und die Telefongesellschaften ließen sich diese Überbrückung gut bezahlen. Vollkommen unterschiedliche und intransparente Tarife für Orts-, Landes- oder internationale Gespräche waren die Folge. Erst im Internet sind Entfernungen nur noch eine Frage von Latenz und unterschiedlichen Zeitzonen. Die Kosten von Kommunikation von einem Internetknoten zum anderen sind fast überall gleich und quasi bei null. Solange die Kosten für Fernkommunikation noch an die Entfernungen gekoppelt waren, bedeutete das, dass mit zunehmender Vernetzung zwar der Nutzen des Netzwerkes für die Teilnehmer stieg, aber dass dieser Nutzen durch die steigenden Kommunikationskosten mit zunehmender Entfernung wieder neutralisiert wurde.
Ein zweiter Kommunikationskostenfaktor ist der der sozialen Komplexität. Bei der Einführung der kommerziellen Telefonie um 1848 in den USA wurden alle Telefone noch zu sogenannten Party Lines zusammengeschlossen. Wenn man den Telefonhörer abnahm, war man mit allen Teilnehmern des Telefonnetzes gleichzeitig verbunden. Ein grandioses Chaos, das zu vielen interessanten sozialen Situationen führte, aber die Nutzer auch schnell überforderte. Erst als die Schalttafeln für Einzelverbindungen der Teilnehmer untereinander 1878 Einzug hielten, wurde diese Komplexität wieder auf ein handhabbares Maß reduziert.
Das Internet durchlief in seiner Entwicklung vom Entstehen hin zu seiner jetzigen Form eine ähnliche Entwicklung: Zunächst waren Chatrooms und Foren im Web der Ort, an dem sich Menschen austauschten. Genau wie die Partylines in der Frühzeit des Telefons spricht der Nutzer dort in einen Raum hinein und alle, die sich zu diesem Zeitpunkt virtuell in diesem Raum befinden, können mitlesen, antworten und so mit dem ursprünglichen Sender in Kontakt kommen – egal, ob dies ursprünglich von diesem antizipiert worden war oder nicht. Zwar gab es mit Angeboten wie EMail auch bereits eins-zu-eins Kommunikation, die innerhalb kürzester Entwicklungszeit mit Instant Messengern ergänzt wurden, aber nichts davon war wirklich neu: Die bidirektionale Kommunikation kennen wir bereits aus der analogen Welt, genauso wie die Kommunikation mit einer Masse von Menschen. Erstere ist denkbar einfach, letztere erreicht schnell ihren Grenznutzen, je mehr Leute am Gewimmel teilnehmen. Wer schon mal in einem Meeting mit mehr als drei Leuten saß, kennt dieses Scheitern an der Komplexität.
Doch die eigentliche Komplexitätsrevolution kam erst mit dem sogenannten Social Web. Mithilfe von gut skalierbaren relationalen Datenbanken können komplexe soziale Verhältnisse abgebildet werden. Relationale Datenbanken speichern Daten in voneinander unabhängigen Tabellen. Zusätzlich kann man die Beziehung der Datensätze untereinander in sogenannten Verknüpfungstabellen speichern. Erst mit der Abfrage der Datenbank – die bei relationalen Datenbanken in einer speziellen Abfragesprache (SQL) verfasst wird – können die komplexen Verknüpfungen dann mit aufgerufen werden. Die Freundschaften bei Facebook zum Beispiel oder die Abonnements bei Twitter sind eigentlich nichts anderes, als eine solche Verknüpfungstabelle, die die eigentlichen Profildaten miteinander verknüpfen. Das soziale Netzwerk ist also ein rein virtuelles Netzwerk, gespeichert in den Tiefen der Datenbanktabellen auf den Servern einer zentralen Recheneinheit. Neben dem »Raum«, in dem alle gemeinsam sprechen, und der einfachen bidirektionalen Konversation gibt es nun den Graphen, ein komplexes Geflecht aus den selbstgewählten Beziehungen, die man in einem sozialen Netzwerk knüpfen kann.
Diese beiden Entwicklungen, die die Kommunikationskosten kollabieren ließen, entfesselten die Netzwerkeffekte. Das ist der Grund, weshalb Internetplattformen ein so scheinbar unbegrenztes Wachstum feiern. Je größer sie werden, desto größer wird die Attraktion und der soziale Druck, sich ihnen anzuschließen. Man kann deswegen die Netzwerkeffekte als »soziale Gravitation« bezeichnen. Und diese Metapher trägt weiter als man denkt.
Als 2006 eine eigens dafür einberufene Kommission den Begriff »Planet« neu fasste, fiel Pluto durch das Raster. Pluto, jahrzehntelang das kleine, abseitige Nesthäkchen in unserem Sonnensystem, wurde von heute auf morgen der Planetenstatus entzogen. Der entscheidende Satz dazu in der neuen Planetendefinition lautet: »[Ein Planet ist ein Objekt, das] das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn ist, das heißt, diese über die Zeit durch sein Gravitationsfeld von weiteren Objekten ›geräumt‹ hat.« Pluto wurde der Planetenstatus aberkannt, weil sich in seiner Umlaufbahn teilweise größere Gesteinsbrocken als er selbst finden. Pluto hatte im Gegensatz zu Facebook seine Umlaufbahn nicht geräumt, sein Gravitationsfeld wirkte nicht stark genug.
Und damit sind wir wieder bei Facebook. Wenn Mark Zuckerberg eskalierende Milliardensummen für Start-Ups ausgibt, dann tut er dies, um seine Umlaufbahn frei zu räumen. Facebook räumte seine Umlaufbahn frei, als es Myspace aus dem Orbit rammte. Facebook räumt seine Umlaufbahn frei, als es sich Instagram und WhatsApp einfach einverleibte. Alles, was eine hinreichend direkte Konkurrenz zu Facebooks Funktionalität bildet und eine rasant wachsende Nutzerbasis hat, kann Facebook im Handumdrehen brandgefährlich werden.
Und Facebook ist nicht alleine. Auch andere große digital agierende Unternehmen gehen diesen Weg, um ihre Marktmacht zu sichern: Ebay räumt seine Umlaufbahn von anderen Auktionsplattformen, Amazon von anderen Onlineversandhäusern etc. Die von Kommunikationskosten befreiten Netzwerkeffekte sind das eigentliche Spiel um den Thron im Internet. Es sind viele Königshäuser da draußen, die ihre Umlaufbahnen freihalten, sie gelegentlich verlassen und kollidieren. Je länger dieses Spiel geht, desto klarer wird, dass es dem Game of Thrones ähnelt: The winner takes it all.
2. An den Grenzen der Menschheit
»When you play the Game of Thrones, you either win or die, there is no middleground« heißt es bei Game of Thrones. Wir befinden uns mitten im Spiel um den eisernen Thron. Einige Königshäuser haben bereits beträchtliche Macht akkumuliert, immer wieder kommt es zu Konflikten, Kollisionen und Machtspielen. Und alle kämpfen nicht nur um den Thron, sondern auch um ihr Überleben.
Facebook hat ein Problem. Es kann nicht mehr weiter wachsen, denn es ist an die Stratosphäre der Menschheit gelangt. Hier oben ist die Luft dünn. Etwa die Hälfte der ans Internet angeschlossenen Menschheit hat bereits ein Facebook- Konto. Die andere Hälfte ist für Mark Zuckerberg nur sehr schwer zu bekommen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Menschen von Facebook noch nichts gehört haben und so muss es andere Gründe haben, warum sie den Dienst nicht nutzen. Entweder haben sie sich bereits bewusst gegen Facebook entschlossen oder aber sie können Facebook nicht nutzen, weil sie zum Beispiel in Ländern wohnen, wo der Dienst geblockt wird. Da dazu neben China auch viele andere sehr bevölkerungsstarke Länder gehören, sind das sehr viele Menschen.
Diese Grenze sieht man bereits im Wachstum. Zwar wächst Facebook immer noch, aber immer langsamer. Der Wachstumsgraph wird zur Asymptote, er nähert sich langsam aber sicher einem Null-Wachstum an. Die positiven Netzwerkeffekte versiegen langsam aber sicher an den Grenzen der Menschheit. In den entwickelten Ländern fallen bereits die Nutzer-Zahlen und die Nutzungsdauer stetig. Nur die Wachstumsmärkte halten den Wachstumstrend aufrecht. Eine Studie der Princeton Universität sieht Facebook bereits 2017 auf dem Schrumpfungskurs.
Das ist gefährlich, denn die positive Rückkopplung, die die Netzwerkeffekte ja bewirken sollen, besagt eben nicht nur, dass ein Dienst, der im Wachstum begriffen ist, dadurch attraktiver wird. Positive Rückkopplung bedeutet auch, dass ein Dienst, der schrumpft, immer unattraktiver wird. Wenn immer weniger Menschen, mit denen ich interagiere, den Dienst nutzen, sinkt auch der Nutzen, den der Dienst mir stiftet. Die positive Rückkopplung hat auch einen Rückwärtsgang. Würde das geschehen, würde Facebook in eine sich selbst beschleunigende Schrumpfungsspirale geraten. Es würde den Berg rückwärts hinunterrollen, den es erklommen hat.
Henry Ford hatte nach dem ersten Weltkrieg ein ähnliches Problem. Er war zu erfolgreich. Mithilfe des Fließbandes, strenger Arbeitsteilung und innovativer Managementtechnik hatte er seine Konkurrenz deklassiert. Er konnte schneller, besser und billiger Autos produzieren als alle anderen. Ähnlich wie Zuckerberg ist auch Ford ein Getriebener der positiven Rückkopplung. Der sogenannte Skaleneffekt besagt, dass mit steigender Produktionsstückzahl die Grenzkosten pro produziertem Stück sinken. Mit anderen Worten: Je mehr man produziert, desto billiger kann man produzieren und damit auch verkaufen – was in der Theorie die Nachfrage verstärkt, weswegen man mehr produzieren kann.
Ford-Autos waren sehr populär und beinahe jede Familie, die es sich leisten konnte, hatte sich bereits eines gekauft. Und das war das Problem: Die vorhandene Nachfrage war erfüllt und der Markt in seiner Form gesättigt. Das Wachstum stagnierte und Ford suchte nach neuen Möglichkeiten, dieser Stagnation entgegenzuwirken, die Nachfrage wieder anzukurbeln und in der Folge wieder mehr Autos zu verkaufen. Im Zuge dieser umsatzgetriebenen Problemstellung kam dem Unternehmer die wesentliche Idee, die den Begriff des »Fordismus« erst allgemein etablieren sollte. Er zahlte seinen Arbeiter einfach Lohnzuschüsse und gab ihnen das Wochenende frei – Konzessionen, die rein betriebswirtschaftlich unsinnig waren, kosteten sie ihn doch einfach Geld. Die Kalkulation war aber eine andere: Mit dem extra Geld und den freien Wochenenden hatten die Arbeiter einen Anreiz, selbst einen Ford zu kaufen. Ford produzierte also neben Autos auch gleichzeitig seine Kunden mit.
Facebook und Google müssen sich an Henry Ford ein Beispiel nehmen und jetzt, wo der bestehende Markt gesättigt ist und die Nutzerstruktur längst nicht mehr in der Form anwächst, wie es die Unternehmen aus ihren Anfangsjahren gewöhnt sind, neue Nutzer »produzieren«. Praktisch bedeutet das, dass die Konzerne seit einiger Zeit daran arbeiten, das Gesamtvolumen des digitalen Marktes auszubauen. Facebook tut das zum Beispiel mit seinem Projekt Internet.org. Die Domainendung .ORG wird häufig von gemeinnützigen Organisationen wie NGOs benutzt. Internet.org tritt entsprechend als gemeinnützige Aktion auf und verspricht, strukturschwache Regionen an das Internet anzuschließen. Facebook hat dafür mehr als einen Weg vorgesehen, aber die spektakulärste Variante ist wohl, dass Facebook gedenkt Satelliten ins All zu schicken und mit segelfliegenden autonomen Drohnen W-Lan-Zugang anzubieten. Derzeit wird aber die größte Masse an Menschen dadurch erreicht, dass man in Zusammenarbeit mit lokalen Providern Internetzugänge subventioniert. Bereits seit langem konnte man in vielen Ländern der Welt unter der Domain 0.facebook.com Facebook aufrufen, ohne dass dafür Daten abgerechnet wurden. Diese Zusammenarbeit wird unter dem Banner der guten Sache ausgedehnt. Netzaktivisten sehen darin eine Verletzung der Netzneutralität. Spezielle Dienste wie Facebook aus den Bezahltarifen herauszunehmen, kommt einer Bevorzugung gleich. Facebook zementiert damit seine Vormachtstellung gegenüber allen anderen Netzdiensten und macht so jeden Wettbewerb zunichte.
Für Google ist so ein Vorgehen nichts wesentlich Neues. Das Motto ›Was gut für das Wachstum des Netzes ist, ist gut für uns‹ war schon ein wesentlicher Baustein von Googles Wachstumsstrategie. Schon immer bot der Konzern mit dieser Begründung Tools und Dienste kostenlos und sogar werbefrei an, nur um mehr Menschen ins Internet zu ziehen – potentielle Kunden. Auch Infrastrukturmaßnahmen stehen dabei vermehrt auf dem Programm. In der westlichen Hemisphäre versucht der Konzern mit Google Fiber Highspeed-Internet einzuführen, das den Namen verdient. In Pilotprojekten wurden Haushalte mit echter Glasfaser mit Gigabit-Anschlüssen versorgt. Zum Vergleich: Die Telekom bietet im Highprice-Segment derzeit höchstens 100 Megabit an. Ein Zehntel.
Aber auch in den strukturschwachen Regionen engagiert sich Google. Mit dem Project Loon will der Konzern Heliumballons in die Stratosphäre schicken, so hoch, dass sie aus den wetterbedingten Unkalkulierbarkeiten entfliehen und dennoch genug Auftrieb haben. Diese fliegenden Sendestationen auf halbem Weg ins All können auch große Regionen mit W-Lan oder Mobilfunk versorgen.
Die Strukturschwache Region in Game of Thrones liegt jenseits der »Wall« und wird immer nur als »the north« bezeichnet. Die »Wall« ist eine viele hundert Meter hohe Mauer aus Eis, die den gesamten Kontinent Westeros von dem Territorium im Norden abschneidet. Hier tut Jon Snow seinen Dienst, verteidigt Westeros gegen die sogenannten »Wildlinge«. Es sind »wilde« in Horden lebende Menschen, zurückgelassen jenseits der Zivilisation im ewigen Eis. Sie versuchen immer wieder, die Mauer zu überwinden und brandschatzen, plündern und morden, wenn sie es schaffen.
»You know nothing, Jon Snow« bezieht sich auch auf die Unwissenheit und den Vorurteilen gegenüber den »Wildlings«, zu denen eben auch Ygritte gehört. Jon überwindet seine Vorurteile und versucht schließlich, einen Pakt mit den Wildlings zu schließen. Er geht diesen schwierigen Schritt, denn er braucht ihre kämpferische Stärke, so wie Google und Facebook die vielen neuen Internetnutzer aus den strukturschwachen Gegenden brauchen.
3. Die Macht des Unbelebten
Jon Snow braucht die Wildlings, um die die Armee der »White Walkers« aufzuhalten. Diese Armee – bestehend aus bereits gestorbenen und zombiefiziert wieder auferstandenen Menschen – marschiert vom Norden auf die »Wall« zu. Während die mächtigen Königshäuser sich gegenseitig in Westeros bekämpfen, sind es die White Walkers, die in überwältigender Anzahl den gesamten Kontinent bedrohen. Und Ygrittes immer dringendere Ermahnung bezog sich eben auch auf diese Armee, die für Snow und seine Mitmenschen unsichtbare Gefahr aus dem Norden, die den Wildlings bereits seit langem ausgeliefert sind. »You know nothing, Jon Snow!«
Das Spiel um die Netzwerkeffekte wird in der Wirtschaftswissenschaft meist anthropozentrisch gedacht. Egal ob Telefon, Computer oder Facebook, am Ende sind es immer Menschen, die aus dem Netzwerk einen Nutzen ziehen und am Ende sind es auch immer wir Menschen, die diesen Nutzen stiften. Wer denn auch sonst? »You know nothing, Jon Snow!«
In den Sozialwissenschaften und bestimmten Richtungen der Philosophie hat sich eine solche Sichtweise längst überholt. Die Wichtigkeit von nichtmenschlichen Akteuren wird von modernen soziologischen Theorien wie der Akteur-Netzwerk-Theorie von Bruno Latour radikal einbezogen. Die Idee der ANT ist, dass soziale Situationen nicht mehr anhand von Metakonzepten wie Gruppen, Gesellschaft oder Systemen beschrieben werden sollten, sondern von den viel konkreteren Bindungen eines Netzwerkes. Dabei werden Hierarchien und Entfernungen ebenso nivelliert wie der Unterschied zwischen Makro- und Mikro-Ebene. Übrig bleiben nur die zu einem Netzwerk verwobenen Akteure. Bruno Latour erkannte früh, dass diese Akteure eben nicht nur Handelnde im klassischen Sinne sein können, sondern dass Texte, Messapparate, Graphen, Formeln und andere Artefakte einen ebenso wichtigen Einfluss auf eine Akteurskonstellation ausüben können wie Menschen. Je nach analytischer Situation lassen sich so Akteure identifizieren, die Diskurse und Erkenntnisse produzieren und sich gegenseitig Handlungsmacht (Agency) übertragen. Latour will seinen Netzwerkbegriff allerdings nicht mit technischen Netzwerkbegriffen verwechselt sehen. Und doch kann er nicht anders, als auch technische Netzwerke als Akteurs-Netzwerke zu verstehen, nur eben als verstetigte, statische Varianten.
2012 legte Ian Bogost einen Vorschlag für eine universelle Phänomenologie der Dinge vor. In seinem Buch Alien Phenomenology, or What It’s Like to Be a Thing geht er über Latour hinaus, indem er den Dingen nicht nur Handlungsmacht, sondern auch Perzeptionsvermögen zuspricht. In seiner auf Graham Harmans objektorientierten Ontologie auf bauenden Phänomenologie entwirft er den Blick des Dings auf die Dinge, einen Blick, der vom menschlichen Blick völlig verschieden ist. Anspielend auf die bekannte philosophische Spekulation von Thomas Nagel: What It’s Like to Be a Bat von 1974 versucht er, mithilfe von Metaphorik einer Vorstellung davon nahezukommen, wie Dinge die Welt wahrnehmen. Sein Bezug auf technologische und gar digitale Artefakte ist weitaus stärker ausgeprägt als bei Latour. So untersucht Bogost unter anderem die Wahrnehmung von Computerspielen und des Video-Interfaces des Atari-Computers.
Auch wenn Netzwerkeffekte weder bei Latour noch bei Bogost eine Rolle spielen, so lässt sich doch die Grundannahme von rezipierenden und agierenden Netzwerkteilnehmern auf sie übertragen. Genau genommen war die Annahme, dass Netzwerkeffekte nur durch Menschen verursacht und abgeschöpft werden, schon immer abwegig. Menschen kommen ins Netz, um dort die Dienste und Werkzeuge zu nutzen. Am besten lässt sich das anhand von Apples AppStore zeigen. Ökonomen sprechen hier von einem zweiseitigen Markt, getrieben von wechselseitigen Netzwerkeffekten. Sie sehen auf der einen Seite eine große Masse von kaufbereiten Menschen, die gerne Apps nutzen wollen. Auf der anderen Seite sehen sie die programmiermächtigen Entwickler, die deren Bedürfnisse erfüllen wollen. Beide Seiten, so die Ökonomie, profitieren von dem Wachstum der jeweils anderen Seite.
Doch sind es wirklich in erster Linie die Nutzer und Entwickler, die sich hier gegenüberstehen? Sind es nicht vielmehr deren Artefakte – die Apps –, die den Nutzen stiften? Ist die Anzahl der Entwickler nicht völlig egal für den Nutzen, den diese Artefakte stiften? Wenn all die Millionen Apps von nur wenigen, oder gar nur einem einzelnen Entwickler entwickelt worden wären, würde das irgendeinen Unterschied für die Netzwerkeffekte machen? Und sind es nicht auch die verbauten Sensoren, die von der sie benutzenden App-Vielfalt profitieren? Wie sehen die wechselseitigen Netzwerkeffekte von Hardware- und Software-Features bei Smartphones aus? Wie die zwischen den Plattformen iOS (mobile Geräte) und denen von OSX (Desktop Betriebssystem)?
Weiter gedacht: Wieso soll der Markt nur zwei Seiten haben? Sind es denn nicht auch die vielen Newsangebote, speziellen Blogs, Podcasts und Nutzer-Foren zu Geräten mit Apples iOS, die das Betriebssystem attraktiver machen und somit auch den Nutzen einer Plattform erhöhen? Sind es nicht die vielen Zusatzgeräte, spezialisiert auf deren Schnittstellen, die ebenfalls ihren Teil hinzufügen? Ist ein Betriebssystem nicht weniger ein zweiseitiger Markt als vielmehr ein komplexes, weit verzweigtes Ökosystem? Ein Ökosystem der Dinge?
Ausgestattet mit all diesem theoretischen Rüstzeug stehen wir nun an der nächsten Zündstufe der digitalen Evolution: dem Internet of Things. Das Internet der Dinge (oder auch Ubiquitus Computing) ist ein Sammelbegriff für die Tatsache, dass wir nach und nach anfangen, alle möglichen Dinge mit Mikrochips und Sensoren auszustatten, und diese mit einer Anbindung an lokale Netzwerke oder eben dem Internet versehen. Die Dinge werden ihrer Umwelt gewahr und beginnen miteinander zu kommunizieren.
Dabei deckt der Begriff Internet of Things (IoT) bereits sehr viele unterschiedliche Entwicklungen ab: Smart Homes bezeichnet die fortschreitende Entwicklung, Haushaltsgeräte mit intelligenten Chips auszustatten, damit sie fernsteuerbar werden und auf ihre jeweilige Situation halbautomatisch reagieren. Intelligente Stromzähler, Mediacenter und mit dem Handy bedienbare Türschlösser gehören dazu. Wearables sind dagegen intelligente Accessoires, die man am Körper trägt. FitBit-Armbänder, die die Schritte zählen, SmartWatches, die den Puls und andere Körperdaten messen und eine Ergänzung zum Smartphone sein sollen. In der Industrie 4.0 interagieren mit Intelligenz ausgestattete Maschinen miteinander und organisieren dynamische Produktionsprozesse. Dadurch sollen Kosten gespart, die Produktion agiler gemacht und dadurch mehr Individualisierung für die Kunden geboten werden. Bei den Smart Cities geht es darum, den städtischen Raum mit Sensoren auszustatten. Der Mülleimer, der weiß, wann er voll ist, die Ampelanlage, die auf ihre Umwelt reagiert. Demnächst werden autonome Flug-Drohnen und selbstfahrende Autos auf den Markt kommen – auch sie sind Teil des IoT.
Der Treiber hinter dem IoT sind die immer kleiner und billiger werdenden Computerchips. Ein Trend, der im Sinne von Moores Law weiterhin anhalten wird. Das Internet of Things ist daher ein Begriff für eine Übergangszeit. Dass jedes Ding auch ein Computer sein wird, der mit Sensoren und Intelligenz ausgestattet ist, das wird in zehn Jahren so selbstverständlich sein, dass es dafür dann keinen Begriff mehr braucht.
Als Henry Ford damals begann, seine eigene Nachfrage zu produzieren, indem er seine eigenen Arbeitnehmer zu Kunden machte, musste er noch auf Menschen als Akteure zurückgreifen. Apple, Google und vielleicht bald auch Facebook werden bald nicht mehr auf Menschen angewiesen sein, wenn es darum geht, die Netzwerkeffekte am Laufen zu halten. Der Kampf wird nicht mehr um die Vormachtstellung bei menschlichen Akteuren gehen, sondern um die Frage, wer die Armee der Leblosen befehligt, die viel, viel größer sein wird als die kleine Gruppe von Menschen und ihren Geräten, die das heutige Internet ausmachen.
4. Das Babel der Dinge
Wir sind bei der Entwicklung des Internets der Dinge derzeit noch in der Phase, in der das Web Mitte der 1990er Jahre war. Es gibt nur wenige sinnvolle Anwendungszwecke und eine Plattform wie Facebook ist noch nicht vorstellbar. Es wird viel experimentiert und der Markt ist noch nicht groß, aber die Potentiale sind riesig. Der Netzwerkausstatter CISCO errechnete, dass bis 2020 etwa 75 Milliarden Sensoren ans Internet angeschlossen sein werden. IBM geht für das Jahr 2030 sogar von circa 100 Trillionen aus.
Wenn das Internet der Menschen der Gravitation des Sonnensystems entspricht, wird das Internet der Dinge eher einer Galaxie gleichen. Die Netzwerkeffekte werden um das schwarze Loch im Zentrum kreisen, das alles in sich hineinzieht und seine Gravitation damit nur noch weiter steigert.
Für die Netzwerkeffekte kommt es weniger darauf an, ob Akteure menschlich oder nichtmenschlich sind, sondern ob sie miteinander interagieren können. Um das zu gewährleisten, müssen sie eine gemeinsame Sprache sprechen. Facebook war Mitte der 1990er Jahre noch nicht denkbar. Es gab zwar eine gemeinsame Plattform – das Web – aber dieses war so generisch, dass es zunächst viele miteinander inkompatible Systeme (Websites) schuf. Aber so wie Facebooknutzer nur kommunizieren können, weil sie eine einheitliche Infrastruktur dafür zur Verfügung haben, werden auch die Dinge als Ganzes nur interagieren können, wenn sie eine gemeinsame Plattform haben.
Plattformen können verstanden werden als homogene Schnittstellen, die als Infrastruktur allerlei Interaktionsmöglichkeiten unter den Teilnehmer eines Netzwerkes ermöglichen. Sie sind die Bedingung der Möglichkeit von Vernetzung und deswegen selbst oft unsichtbar. Aber gerade dort, wo die Vernetzung im Entstehen ist, es also noch keine solche allgemeine Plattform gibt, wird das Spiel um die Definitionsmacht der Vernetzung gespielt. Das Game of Things ist der Kampf um die Sprache der Dinge. Wer die Schnittstellen kontrolliert, wird die Netzwerkeffekte ernten.
Die derzeitig wichtigsten Anwärter in diesem Spiel sind Apple und Google. Google verfolgt einen Cloud-zentrierten Ansatz. Sein Handy-Betriebssystem Android ist jetzt schon in vielen Dingen verbaut: Autos, Fernseher, Kühlschränke. Sie alle sollen über das Internet mit Googles zentralen Servern reden, wo die Daten zusammengeführt werden und die Geräte zentral einsehbar und steuerbar sind. Der Nutzer greift mit einer Smartphone-App darauf zu. Auch bei Apple wird das Smartphone die Schaltzentrale des Internet of Things sein. Im Gegensatz zu der Lösung, die Google auf seiner Entwicklerkonferenz I/O vorgestellt hat, sollen die Daten bei Apple aber nicht über zentrale Server zusammenkommen, sondern die Geräte sollen sich untereinander direkt austauschen. Das Thermostat spricht mit der Heizung, beide sprechen wiederum mit dem Smartphone, und vielleicht synchronisieren sie sich noch mit dem Homeserver.
Man wird sich also für Apples Lösung entscheiden können – die durch den Verzicht auf einen zentralen Server etwas schonender für die Privatsphäre ausfällt, aber dafür beschränkter im Funktionsumfang ist – oder für Googles Ansatz – der über die Auswertung des Gesamtnutzerverhaltens wahrscheinlich hilfreiche Tipps, aber auch lästige Werbung generieren kann.
Neben den beiden Großen gibt es bei dem Game of Things noch viele weitere Anwärter. Von vielen haben wir wahrscheinlich noch nicht einmal gehört. Derzeit findet die meiste Entwicklung von IoT-Geräten im kleinen Rahmen von Crowdfundingplattformen wie Kickstarter und Indiegogo statt. Kleine Start-ups oder Privatpersonen stellen ihre Vision eines vernetzten Haushaltsgegenstandes vor und lassen sich die Entwicklung von Enthusiasten vorfinanzieren. Dabei kommen mal mehr mal weniger nützliche Gegenstände heraus. Hinzu kommen die vielen Bastler und Tüftler, die mithilfe von günstigen Chipsätzen wie Arduino oder Raspberry Pi selbstgebaute Home-Automation-Projekte durchführen, sich in Blogs und Foren über die besten Setups austauschen und die Steuerungssoftware Open Source stellen. Etwas größere Anbieter wie Smartthings gehen einen Schritt weiter und bieten ganze Sets von Sensoren, Kameras und zum Beispiel Lampensteuerung und Heizungsregulierern an, die sich über eine zentrale Schaltstelle steuern lassen. Natürlich wollen auch die großen, etablierten Hersteller wie Siemens, Miele und Grundig den Trend nicht verschlafen und bieten vernetzte Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseher und sogar Rasierapparate an.
Und all diese Ansätze, Konzepte und Projekte agieren oft mit dem heimischen W-Lan oder per Bluetooth, und meist sind die dabei entwickelten Protokolle spezialisierte Entwicklungen, inkompatibel mit dem Rest. Sie sprechen Privatsprachen, einen ganzen Zoo an spezialisierten, proprietären Eigenentwicklungen, das Babel der Dinge. Deswegen können sie nur das, was sie können sollen. Doch der eigentliche Wert liegt in der Vernetzung all der Geräte und der muss noch gehoben werden.
Die Netzwerkeffekte besagen, dass die Heizung besser funktioniert, wenn sie mit dem Thermostat spricht und weiß, ob das Fenster offen ist. Die Netzwerkeffekte gebieten, dass das Kraftwerk besser funktioniert, wenn es mit allen Thermostaten auf Du ist und Sensoren entlang der Stromtrassen hat. Das Kraftwerk will über die Lieferketten seines Treibstoffs bescheid wissen, genauso wie der Techniker, der das Stromnetz kontrolliert. Das Stromnetz braucht Informationen darüber wie der Verkehr in der Innenstadt fließt, die Autoindustrie ebenfalls, um ihre Produktionsstraßen anzupassen. Die Solarzelle will mit den Wetterstationen sprechen, die Wetterstation mit der Klimaanlage, die Klimaanlage mit dem Türschloss, das Türschloss mit dem Auto, das Auto mit allen anderen Autos und der Straßenverkehrsleitstelle. Der Kühlschrank braucht eine Idee davon, was in ihm steht und alle, alle, alle wollen mit der Smartwatch reden – vor allem, sobald das Garagentor aufgeht. Die Netzwerkeffekte werden eine ungeahnte Traktion erfahren, denn am Ende muss alles mit allem interoperabel sein.
Am Ende muss eine Sprache all die Dinge sinnvoll verbinden. Apple, Google und die vielen anderen Adelshäuser werden alles dafür tun, diejenigen zu sein, die diese Sprache vorgeben. Es ist dann am Ende egal, wer die Geräte herstellt und verkauft. Das Facebook of Things zu sein, das ist der Eiserne Thron der Dinge.
Doch es gibt eine Alternative. Es muss kein einzelnes Unternehmen sein, dass die Protokollebene kontrolliert. Das Internet selbst wird von keiner zentralen Instanz kontrolliert und doch bietet es die Grundlage der meisten Kommunikation, die wir in der digitalen Welt tun. Das Netz der Netze steht auch bereit, Grundlage für das IoT sein zu können. Heute schon enthält es den Kern für ein allgemeines Protokoll der Dinge, dezentral organisiert, weltweit erreichbar, offen für alle, die auf dieser Grundlage entwickeln wollen.
Dass das Internet mehr Adressen braucht, als die ursprünglichen im Protokollstandard vorgesehenen, wussten die Netzingenieure bereits seit 1998. Damals haben sie schon einen neuen Internetstandard verabschiedet. Das dem Internet zugrundeliegende Netzwerk-Protokoll »IP«, also »Internet Protokoll« ist dafür zuständig, dass die Daten von A ihren Weg nach B finden. Die dafür vorgesehene Adressierung nennt man deswegen IP-Adressen. Sie sind diese in vier voneinander mit Punkten getrennten Nummernblöcke, etwa 233.154.98.67. Jede der durch einen Punkt getrennten Stellen entspricht ein Byte (8 Bit). Mit einem Byte lassen sich 256 Zustände darstellen, weswegen jede der Stellen eine Zahl zwischen 0 und 255 annehmen kann. Das ergibt also etwas über vier Milliarden mögliche IP Adressen, die zu verteilen sind. Jedes Gerät, das im Internet kommunizieren will, braucht eine solche Adresse, und diese Adressen werden knapp. Eigentlich gibt es kaum noch freie. Natürlich sind viele unbenutzt. In der Frühphase wurden sie zu großzügig vergeben. Apple beispielsweise besitzt alleine ein Class-A Netz, also ein Netz, dessen erste Stelle fix ist und alle anderen frei definieren kann, was immerhin 16,7 Millionen IP-Adressen entspricht.
Doch Rettung naht. Das bisherige Internet Protokoll (Version 4) soll durch ein neues ersetzt werden (Version 6). Technisch ist es beinahe auf allen Geräten bislang vorinstalliert. Alleine die Internetprovider zieren sich noch bei der Umstellung. IPv6 hat eine 128 Bit-Adressierung, im Gegensatz zur 32 Bit- Adressierung von IPv4. Das erhöht die Möglichkeiten dramatisch. 340 Sextillionen IP-Adressen werden damit möglich. Eine Sextillionen ist eine 1 gefolgt von 36 Nullen. Damit könnte jedem Sandkorn auf der Erde eine IP-Adresse zugewiesen werden. Wir können aber derzeit auch nicht ausschließen, dass Sandkörner nicht dereinst beim Internet of Things eingemeindet werden.
Für das Internet der Dinge ist IPv6 derzeit die größte Chance, sich nicht auf Dauer von einem Unternehmen dominieren zu lassen, und dennoch die Netzwerkeffekte für alle abschöpfen zu können. Natürlich kann IPv6 nur die Grundlage liefern, auf der weitere Protokolle aufsetzen müssen. Wie diese aussehen müssen, ist heute noch schwer zu sagen, denn wir sind noch mitten drin, in der Experimentierphase. Es muss gewährleistet sein, dass die Dinge sich gegenseitig sehen und erkennen, dass sie Messtandards verstehen, Daten austauschen können, sich vielleicht auf Dialekte einigen können. Auf die Frage: »How it’s like to be a thing?« müssen jetzt die Entwickler eine weniger spekulative, sondern eine normative Antwort geben. Dabei ist es wohl unvermeidlich, dass einzelne Unternehmen erstmal mit eigenen Standards vorpreschen und am besten mit anderen Standards konkurrieren. Auf lange Frist wollen sich aber weder die Menschen noch die Dinge um Protokollstandards und unterschiedliche Plattformkonzepte die Köpfe zerbrechen.
Die Game of Thrones-Saga ist bekanntlich noch nicht fertig geschrieben. Dessen Autor George R. R. Martin arbeitet zur Zeit der Entstehung dieses Textes an dem sechsten Band. Wir wissen noch nicht, wie die Schlacht zwischen White Walkers und Menschheit ausgehen wird. Ein ebenfalls immer wiederkehrendes Sprichwort aus der Saga ist »Winter is coming«. Der große Winter ist die Ankündigung der mythischen Ära der Kälte, eine Zeit, in der die White Walkers durch Westeros marschieren werden. Wahrscheinlich wird es noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis wir die großen Schlachten um das Game of Things erleben werden. Vielleicht werden sie dann von völlig anderen Akteuren geführt werden, als die, die wir heute für die wichtigsten Anwärter halten. Die Unvorhersehbarkeit der Ereignisse im volativen Plattformmarkt könnte der Feder von George R. R. Martin entsprungen sein. Sicher ist nur eines: »Winter is Coming«.