/*******
Dieser Text erscheint in der Akzente-Ausgabe „Automatensprache“ von Mai 2024, in dem auch viele andere tolle Texte zum aktuellen KI-Hype enthalten sind.
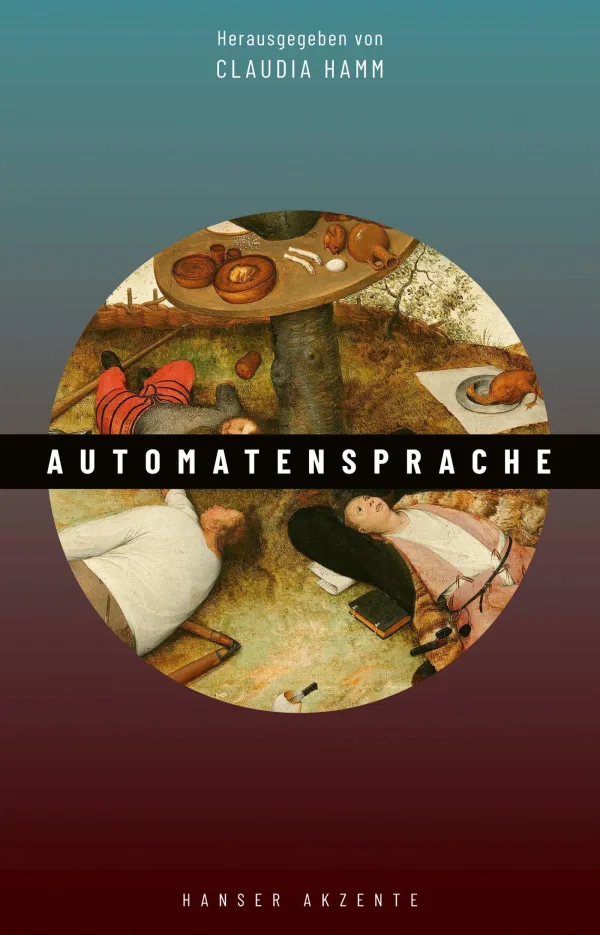
*******/
In einem Interview vom März dieses Jahres sprach Sam Altman, CEO von OpenAI, – der mächtigsten KI-Firma der Welt – einen Satz aus, der ihm sofort unangenehm wurde. Er sagte: „Der Weg zu AGI sollte ein gigantischer Machtkampf sein.“ AGI (Artificial General Intelligence) markiert innerhalb der Branche die Erreichung von menschengleicher, genereller Maschinenintelligenz und ist das offizielle Ziel aller KI-Startups und -Konzernabteilungen. Altman korrigierte sich schnell: Er wünsche sich diesen Machtkampf nicht, aber er erwarte ihn.
Der Satz fällt an der Stelle, als es im Interview um seinen eigenen Machtkampf um die Kontrolle von OpenAI geht. Wenige Monate zuvor, im November 2023, feuerte ihn das Board des Unternehmens überraschend als Geschäftsführer. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und da das Board nur sehr vage Andeutungen über die Gründe machte, spekulierte die halbe Welt über den plötzlichen Rausschmiss.
Es ist wichtig, dabei zu verstehen, dass OpenAI keine Firma wie andere Firmen ist. Sie wurde bewusst als Non Profit Organisation (NGO) gegründet, um ethisch verantwortungsvolle KI-Forschung sicher zu stellen, doch unter Altman etablierte sie einen For-Profit-Arm, um Milliarden Dollar an Venture Capital einsammeln zu können, die nötig wurden, um die immer teurer werdenden KI-Modelle zu finanzieren. Das Board aber ist Teil der NGO-Struktur und hat die Aufgabe, über die ethischen und verantwortungsvollen Standards der Organisation zu wachen und hat über alle Geschäftsfelder das letzte Wort. Ein Rausschmiss des CEO ist der letzte Nothebel zur Sicherung dieser Kontrolle und genau so begründete das Board auch seine Entscheidung: Es habe das Vertrauen in Altman verloren.
Doch innerhalb weniger Tage änderte sich alles. Altman hatte es geschafft, einen Großteil der Mitarbeiter auf seine Seite zu ziehen, die auf einmal in einer Petition mit ihrer Kündigung drohten, und Microsoft, der wichtigste Geldgeber und Eigentümer der teuren Serverinfrastruktur, auf der OpenAI die Modelle trainiert und betreibt, stellte Altman in einer Blitzaktion als Chef einer neuen KI-Abteilung ein, die zudem die Bereitschaft signalisierte, auch alle anderen OpenAI-Mitarbeiter aufzunehmen.
Das Board hatte in dem Moment keine andere Wahl mehr als seine Entscheidung rückgängig zu machen. Altman kehrte nach weniger als einer Woche zurück auf seinen CEO-Posten und stattdessen wurde nun das Board neu organisiert.
In dem Interview reflektiert Altman überraschend offen, dass das Board rechtlich befugt war, ihn zu feuern, was seinen letztendlichen Sieg zu einer Art „Governance Failure“ der Organisation mache. Das ist eine niedliche Umschreibung für einen „Coup“.
Wenn Altman recht hat, wird diese Episode nur die erste öffentlich wahrnehmbar ausgetragene Schlacht im größeren Machtkampf um die Zukunft der KI-Technologie gewesen sein, und es werden noch viele folgen. Dass sich Silicon Valley gerade immer mehr zu „Game of Thrones“ verwandelt, hat einen tieferen Grund: Das, was bei OpenAI im Kleinen passierte, ist nur eine Vorahnung dessen, was der gesamten Welt bevorsteht:
KI ist ein Coup.
Einführung
Will man über Künstliche Intelligenz und Demokratie nachdenken, stellt sich als erstes die Frage, von welcher KI und von welchem Konzept von Demokratie wir sprechen. Beide Begriffe sind auf ihre eigene Weise unscharf.
Sprechen wir über aktuell existierende KI-Systeme, wie es sie mittlerweile wie Sand am Meer gibt, die alle unterschiedliche Aufgaben erfüllen und dabei mal mehr mal weniger gut sind? Oder sprechen wir von KI als „Imaginary“, beispielsweise als „AGI“ das, je nachdem, wen man fragt, immer so fünf bis zehn Jahre in der Zukunft liegt?
Beide Begriffe sind auf ihre eigene Art ephemer. Der erste ist bereits veraltet, wenn dieser Text erscheint, und der zweite wird auf absehbare Zeit vage bleiben, und das könnte sich auch so bald nicht ändern.
Wenn ich hier also von „Künstlicher Intelligenz“ spreche, dann meine ich ganz konkret die generative Künstliche Intelligenz, wie sie seit der Vorstellung von ChatGPT im Oktober 2022 in aller Munde ist. Ich will allerdings für diesen Text auch stellenweise das Abenteuer eingehen, die behaupteten Potenziale der Technologie ernstzunehmen, verweise dann aber auch entsprechend auf die spekulative Natur dieser Imaginaries.
Generative KI basiert auf dem schon länger etablierten „Machine Learning“, bei dem künstliche neuronale Netzwerke mit enorm vielen Daten trainiert werden. Eine neue Software-Architektur (das Transformer Modell), als auch der Einsatz bisher unvorstellbarer Datenmengen (Tausende von Gigabyte an Text- und/oder Bilderdaten), sowie viele Millionen Dollar teure Rechenleistung erlauben es nun, allerlei Content zu produzieren, den selbst Experten schwer von menschengemachten Artefakten unterscheiden können.
Seitdem hat der Hype nur noch mehr Schwung bekommen und es werden Ressourcen in Volkswirtschaftsgröße auf die Weiterentwicklung dieser Systeme geworfen, was in einer ungeheuren Beschleunigung der Entwicklung resultiert. Sam Altman sprach bereits davon, dass die nächsten Jahre bis zu 7 Billionen Dollar Investitionen allein in nötige Computerhardware anzustreben seien.
Generative Künstliche Intelligenz ist deswegen ein „moving target“, das seine Fähigkeiten, Features und Kompetenzen in atemberaubenden Tempo ausweitet. Schon jetzt gibt es nur wenig Zweifel an der Nützlichkeit der Technologie, war ChatGPT doch letztes Jahr eine der schnellstwachsenden Apps und wird auch weiterhin rege genutzt. Dennoch sind die Einsatzgebiete noch begrenzt, da diese Systeme alles andere als fehlerfrei und vorhersagbar agieren. Selbst auf denselben Prompt gleicht keine Antwort der anderen und die Systeme „halluzinieren“ am laufenden Band Zahlen, Daten, Personen, Paragraphen und Buchtitel herbei, so dass man den Output nie ungeprüft übernehmen kann, ohne unangenehme Überraschungen zu erleben.
Dennoch spricht einiges für die Technologie. Generative KIs erhöhen die Produktivität von Softwareentwicklern, genauso wie die Produktivität von Schreibtätigkeiten. Sie beschleunigen kommunikative Prozesse, bis dahin, dass sie sie vollkommen automatisieren. Mit KIs können schnell und günstig allerlei Alltagsillustrationen für alle möglichen Zwecke generiert werden, für die man sonst einen Designer benötigte. KIs werden heute immer mehr zum Nachschlagen von Informationen genutzt oder gar zum personalisierten Lernen von komplizierten Zusammenhängen. KIs können erstaunlich gut von vielen Sprachen in andere Sprachen übersetzen. Bereits angekündigt, sollen KIs sogar demnächst selbsttätig Aufgaben erledigen und als „Agents“ etwa eine Reise planen, inklusive Orte recherchieren und die nötigen Tickets und Unterkünfte buchen können. Zudem haben KIs eine kompetenznivellierende Wirkung. Studien zeigen, dass vor allem performanceschwache Arbeitskräfte überdurchschnittlich vom Einsatz von KI profitieren und auch in der Breite der Bevölkerung hilft KI Menschen, die vorher Schwierigkeiten hatten, etwa einen Brief zu formulieren oder sich graphisch auszudrücken. Manche sprechen gar von einer „Demokratisierung“ des Schreibens oder der Gestaltung.
Und da sind wir beim zweiten schwammigen Begriff: der Demokratie. Es gibt etliche Regalmeter von politikwissenschaftlichen Demokratiedefinitionen und Erklärungen. Für unsere Zwecke scheint mir aber vor allem das Framework der Politikwissenschaftler Bruce Bueno de Mesquita und Alastair Smith nützlich, das sie in ihrem Buch Dictator’s Handbook ausbreiten. Zum einen, weil die Theorie sich gut auf Beziehungsnetzwerke anwenden lässt, aber auch, weil sie zynisch und abgeklärt genug ist, um auch auf die Tech-Branche zu passen. Mesquita und Smith vermeiden es, kategoriale Unterschiede zwischen den politischen Systemen zu markieren, sondern versuchen, universelle Regeln der Macht zu formulieren. Eine der zentralsten Prämissen der Theorie ist, dass Machthaber – egal, ob demokratisch oder autokratisch – immer nach Mitteln und Wegen suchen, ihre Macht abzusichern. Eine weitere zentrale Prämisse ist, dass kein Machthaber ohne die Unterstützung von anderen Menschen regieren kann. Die Kunst, an der Macht zu bleiben, besteht also im klugen Management der eigenen Abhängigkeiten.
Dabei unterscheiden Mesquita und Smith zwischen drei Kategorien von Abhängigkeitsbeziehungen: Das „nominelle Selektorat“ ist die austauschbare Verschiebemasse an Menschen, die selbst über keine Hebel der Macht verfügen. Über ihre Köpfe wird hinweg regiert. Daneben gibt es das „tatsächliche Selektorat“. Das ist eine deutlich kleinere Gruppe, die es zu überzeugen gilt, um an die Macht zu kommen und dort zu bleiben. In der US-Demokratie sind das zum Beispiel die Wähler der Swing-States, in Deutschland wichtige gesellschaftliche Gruppen wie die Rentner oder Autofahrer, also alle Gruppen, die bei Wahlen den Ausschlag geben können. Und schließlich gibt es noch die „gewinnende Koalition“, jene sehr kleine Gruppe, von deren Unterstützung ein Machthaber direkt abhängig ist. Das können zum Beispiel Parteifunktionäre oder potente Geldgeber sein, es können auch einfach Menschen in wirtschaftlichen oder publizistischen Machtpositionen sein. Dieser Gruppe gilt der Großteil der Aufmerksamkeit jedes Machthabers.
Politische Systeme unterscheiden sich nun darin, wie es ihnen gelingt, Machthaber von einer möglichst großen, diversen Gruppe von Menschen abhängig zu halten (Demokratie), oder inwiefern es Machthabern gelingt, ihre Abhängigkeiten möglichst auf die „gewinnende Koalition“ zu reduzieren, die sie dann auf Kosten der anderen beiden Gruppen alimentieren können (Autokratie).
Dabei sind rechtliche Rahmenbedingungen und eingespielte Erwartungen letztlich weniger wichtig als handfeste ökonomisch-materielle Abhängigkeiten. Das OpenAI-Board hatte rechtlich gesehen die Rolle der „gewinnenden Koalition“, doch Sam Altman wusste genau, dass die „Governance Struktur“ nur ein Zettel mit Buchstaben ist und dass die eigentliche Macht im Wissen und den Kompetenzen der Mitarbeiter (dem tatsächlichen Selektorat) sowie im Zugang zu den gigantischen Rechenressourcen von Microsoft (der eigentlichen gewinnenden Koalition) liegen. Indem er beides auf die eigene Seite zog, herrschte das Board nur noch über eine leere Hülle.
So viel zur Theorie. Doch bevor wir über Demokratie und Künstliche Intelligenz reden, lohnt es sich, zunächst einmal abzuschweifen und sich anzuschauen, was passierte, als das letzte Mal eine Technologie unser aller Leben zum Guten wenden sollte: Das Internet.
Das Internet und die Demokratisierung der Öffentlichkeit
Als im März 1991 das Internet zur kommerziellen Nutzung freigegeben wurde, brach für die Welt eine neue Ära an. Vorher waren nur Universitäten, ein paar Regierungsorganisationen und Großkonzerne ans Internet angeschlossen, und seine Nutzung war hauptsächlich wissenschaftlicher Natur. Es war, als wäre der Welt ein riesiges Geschenk gemacht worden. Eine offene und freie Infrastruktur, damals noch vergleichsweise frei von kommerziellen Zwängen, eröffnete unendliche kommunikative und publizistische Freiheiten. Über die 1990er Jahre bildeten sich Informationsangebote, Communities, neue kulturelle Praktiken und Ausdrucksweisen, und eine ganz neue, sich stetig weiterentwickelnde Kultur entstand. Das Internet sei „der neue Ort des Bewusstseins“, verkündete John Perry Barlow in seiner berühmten Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, einem Text, der wie kein anderer versuchte, den enormen Umbruch in seinem ganzen Pathos zu erfassen. Doch um zu verstehen, was für ein tiefer Einschnitt das Internet für die Menschen war, muss man zunächst verstehen, wie Welt vor dem Internet funktionierte.
Am 5. März 1965 schrieb der Journalist und Herausgeber Paul Sethe einen Leserbrief an den Spiegel, in dem er einen Satz fallen lassen sollte, der zu einem geflügelten Wort in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden würde: „Die Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“
Die Presse war im zwanzigsten Jahrhundert ein Eliteorgan, und obwohl Presse- und Meinungsfreiheit vom Grundgesetz garantierte Rechte waren, hatten nur sehr, sehr wenige Menschen überhaupt die Möglichkeit, sich öffentlich am Diskurs zu beteiligen. Selbst Sethe, ein bekannter und einflussreicher Journalist, griff zum Leserbrief als Mittel der Meinungsäußerung.
Die Hoffnungen, die sich mit dem Internet verbanden, waren nicht völlig naiv, wenn man sie an den damaligen Strukturen misst. In den letzten zwanzig Jahren hat sich das Internet im Allgemeinen und die Social Media Plattformen im Besonderen zum öffentlichen Marktplatz der Weltgesellschaft entwickelt. Hier werden News konsumiert und sofort rege diskutiert, hier wenden sich Experten unvermittelt ans Publikum, hier werden Proteste organisiert und ausgetragen, hier veröffentlichen Politiker ihre politischen Botschaften, statt wie bisher als Pressemitteilung. Was im Internet wichtig ist, kann von den klassischen Medien nicht ignoriert werden, und wenn Journalisten wissen wollen, wie „die Öffentlichkeit“ über ein Thema denkt, machen sie keine Straßenumfragen mehr, sondern lesen Tweets oder suchen bei Tiktok. Ja, das Internet demokratisierte die Öffentlichkeit, zumindest eine gewisse Zeit lang.
Enshittification
Doch wenn man die heutige Situation genauer betrachtet, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, ob das Geschenk des Internets vergiftet war. Internet-Plattformen haben alle Bereiche unseres Lebens durchdrungen, uns in immer tiefere Abhängigkeiten verstrickt und nutzen diese Macht nun immer spürbarer aus. Sie schließen Zugänge, verteuern Services, verschlechtern absichtlich Features und erhöhen Schlagzahl und Länge von Werbeeinblendungen, die darüber hinaus immer weniger als solche erkennbar gemacht werden. „Enshittification“ ist das Wort der Stunde. Der Science-Fiction-Autor und Netzaktivist Cory Doctorow beschreibt damit einen Prozess des mutwilligen kommerziellen Vandalismus der Plattformen an sich selbst, der aus dem Zwang für die Plattformunternehmen motiviert ist, wachsende Renditen bei abgeflauten Nutzerwachstum zu liefern. Der Mechanismus läuft so, dass im ersten Schritt Geschäftskunden und Nutzer zum gegenseitigen Vorteil zusammengebracht werden, im zweiten Schritt wird dann der dadurch entstandene Mehrwert bei den Geschäftskunden (Uberfahrer, Shopbetreiber auf Amazon Marketplace, Werbekunden bei Google und Facebook) durch immer schlechtere, ausbeuterische Konditionen abgeschöpft, bis dann im dritten Schritt der Mehrwert auch bei den Nutzern immer stärker abgeschöpft wird, indem der Service teurer und schlechter gemacht wird. Am Ende landet der komplette Mehrwert der Plattform als Rendite bei den Aktionären.
Herrschte im klassischen Kapitalismus, wer über „die Produktionsmittel“ verfügte, so ist es im digitalen Kapitalismus derjenige, der über die „Mittel der Verbindung“ verfügt. Plattformen haben sich erfolgreich zwischen Shop und Kunden, zwischen Fahrer und Fahrgäste und Informationslieferant und Newsjunkies gequetscht und kassieren nun auf beiden Seiten Wegzoll.
Doch der abgeschöpfte Mehrwert beschränkt sich längst nicht mehr nur auf das Kommerzielle. Silicon Valley hat unsere öffentliche Sphäre in Beschlag genommen und sitzt jetzt an den subtilen Schalthebeln der algorithmisierten Sichtbarkeit von Informationen und Meinungen und exerziert damit immer ungenierter politische Macht. Elon Musk, der letztes Jahr Twitter übernommen hatte, transformiert die Plattform von der wichtigsten digitalen Öffentlichkeit zu einer Nazipropagandawaffe, indem er gezielt Rechtsradikale auf die Plattform holt, Journalisten zensiert, gerichtliche Verfahren gehen NGOs führt und den Empfehlungsalgorithmus auf seine eigenen Posts hin optimiert, mit denen er Verschwörungstheorien über den „Woke Mindvirus“ und den „Great Replacement“ an sein Millionenpublikum promotet.
Macht und Abhängigkeit von Plattformen
Paul Sethe schrieb in dem oben erwähnten Leserbrief weiter: „Da die Herstellung von Zeitungen und Zeitschriften immer größeres Kapital erfordert, wird der Kreis der Personen, die Presseorgane herausgeben, immer kleiner. Damit wird unsere Abhängigkeit immer größer und immer gefährlicher.“
Und hier kommen wir zurück zum Framework von Mesquita und Smith. Ein Machthaber ist immer von anderen abhängig, um seine Macht abzusichern, und hat Anlass, den Kreis seiner Abhängigkeiten möglichst gering zu halten. Vereinfacht ausgedrückt: Ein paar Hundert mächtige Oligarchen (gewinnende Koalition) bei Laune zu halten ist sehr viel einfacher und zuverlässiger zu bewerkstelligen als ein ganzes Volk (nominelles Selektorat), weswegen es rational ist, das Volk zugunsten der Oligarchen auszubeuten. Das bedeutet nicht, dass jeder Machthaber so handelt, aber es bedeutet, dass viele so handeln, sobald sie die Möglichkeit dazu bekommen.
Wie Sethe richtig bemerkt, wird dieser Prozess sehr von ökonomisch-materiellen Abhängigkeiten beeinflusst. In einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft existieren enorm viele kleinteilige, weit verstreute Abhängigkeiten, was es schwierig macht, Macht an einer einzigen Stelle zu konzentrieren. Komplexe, arbeitsteilige Gesellschaften mit hohem Spezialisierungsgrad sind deswegen gegen die Machtergreifung eines Autokraten besser gefeit, denn der Autokrat müsste, um die Gesellschaft am Laufen zu halten, sehr viele Leute auf seine Seite ziehen. In Gesellschaften, die weniger ausdifferenzierte Arbeitsteilung haben, zum Beispiel, weil sie ihr Bruttonationaleinkommen zu einem Gutteil aus dem Export von Rohstoffen verdienen, ist dagegen der Kreis an mächtigen Leuten klein und überschaubar, was dem Machthaber ein leichtes Spiel ermöglicht. Ein Umstand, der in der politikwissenschaftlichen Literatur auch als „Ressourcenfluch“ beschrieben wird.
Etwas Ähnliches beschreibt Sethe für die Presseverlage im zwanzigsten Jahrhundert. Kapitalakkumulation und Skaleneffekte bilden die materielle Basis von sich zunehmend konzentrierenden Abhängigkeiten, die dann im 20sten Jahrhundert zu den zweihundert reichen Leuten führt, die ihre Meinung kundtun dürfen. Und es ist ebenfalls genau das, was die letzten Jahre im Internet passiert ist. Doch im Internet kommen zu den oben genannten Effekten noch die sogenannten „Netzwerkeffekte“ hinzu.
Netzwerkeffekte machen einen Dienst immer attraktiver, je mehr andere Menschen daran teilnehmen. Leute locken andere Leute auf die Plattform und halten sie dort. Hat man einmal seine Beziehungen auf einer Plattform etabliert, fällt es schwer, sie auf andere Kommunikationskanäle umzusiedeln oder zu reproduzieren. Dieser „LockIn“ genannte Effekt macht die einmal auf einer Plattform angesiedelten Nutzer zu einer fast beliebig steuerbaren Masse, was – wie wir von Mesquita und Smith wissen – eine stabile Machtkonzentration an der Spitze erlaubt.
Wenden wir das Dictator’s Handbook auf Plattformen an, wird deutlich, wie das Feld der Abhängigkeiten das Handeln der Plattformunternehmen bestimmt und wie das den Prozess der Enshittification präzise erklärt. In einer frühen Wachstumsphase ist eine Plattform stark auf Zuspruch der Nutzer und Geschäftskunden angewiesen, weswegen sie für die Plattform als „tatsächliches Selektorat“ gilt, dem versucht wird, einen möglichst spürbaren Mehrwert zu bieten. Doch sobald die Wachstumsphase vorbei ist und die Nutzer durch den LockIn-Effekt sowieso an die Plattform gebunden sind, wird ihnen ihre Rolle als lediglich „nominelles Selektorat“ zugewiesen, das zugunsten der Aktionäre (also der „gewinnenden Koalition“) immer stärker ausgebeutet werden kann.
Die Konzentrationsprozesse, die Sethe für die Presseverlagslandschaft beschreibt, hat das Internet im Eiltempo durchgespielt. Es ist in wenigen Jahren von einem Ort der dezentralen und offenen Kommunikation, der niemandem gehörte und in dem alle Informationen gleich behandelt wurden, zu einem Spielball von einer Handvoll Konzernen und Milliardären geworden, die nun von den Plattformen zugunsten weniger Kapitalanleger ausgebeutet werden.
Die Graphnahme durch das Silicon Valley
In meinem Buch Die Macht der Plattformen hatte ich diesen Prozess „Graphnahme“ genannt. Wie die Landnahme bei Carl Schmitt ist die Graphnahme eine ursprüngliche, gewaltsame Aneignung, aber eben nicht von Land, sondern von Beziehungen oder etablierten Interaktionszusammenhängen. Ihre Eroberung besteht darin, diese Interaktionen auf die Plattform zu lenken und in den dortigen Datenbanken abzubilden. Das erhöht zum einen den Komfort und weitet die Interaktionsmöglichkeiten für die Nutzer aus, erlaubt der Plattform aber zum anderen auch, eine enorme Kontrolle über diese Beziehungen auszuüben. Wie die Landnahme errichtet auch die Graphnahme ein eigenes Regime.
Seit dem Aufstieg der Plattformen als neues Paradigma sozialer Organisation hat Facebook den „Social Graph“, Google den „Interest Graph“, Amazon den „Consumption Graph“ und Tiktok den „Entertainment Graph“ unter ihre Kontrolle gebracht. Fast alle von uns leben seither unter ihren AGBs und Moderationsregeln und bekommen unsere Informationen entsprechend ihrer algorithmischen Sichtbarkeitsregimes verabreicht. So viel zur Demokratisierung der Öffentlichkeit.
Diese enorme Machtkonzentration im Silicon Valley hat bereits einige Beobachter dazu verleitet von einem neuen Feudalismus zu sprechen. Die Plattformen haben eine ökonomisch-materielle Stellung in der Gesellschaft erlangt, die ihnen weitestgehend von Leistungen unabhängige Renten beschert und die zu einer Kultur des Größenwahns geführt hat. Allein während der Pandemie haben sich die Vermögen der Silicon Valley Milliardäre vervielfacht, und diese enormen Ressourcen haben nicht nur zu abstrusen Abenteuern wie dem Twitterkauf durch Elon Musk, sondern vielerorts auch zu einem zunehmenden Abdriften in ideologische Abgründe geführt.
Elon Musks öffentliche Kernschmelzen und seine zunehmend unverhohlene Sympathie mit rechtsradikalen Verrschwörungstheorien sind dabei nur das sichtbarste Beispiel einer außer Kontrolle geratenen Elite. Silicon Valley CEOs und „Venture Capitalists“ wie Reid Hoffman (LinkedIn), Peter Thiel (Palantir), Sam Altman (OpenAI) und viele andere hängen abstrusen Theorien und ethischen Frameworks an, wie „Effective Altruism“, „Longtermism“ oder „Effective Accelerationism“. In diesen Theorien wird eine unabwendbare Zukunft imaginiert, in der wir als Menschheit unsere Intelligenz und unser Bewusstsein billionenfach ins ganze Universum tragen. Diese Zukunft wird dabei als unvermeidlich und gleichzeitig als dringend anzustreben vorausgesetzt und dient als normative Folie, um alle Handlungen im Hier und Jetzt danach zu beurteilen, ob sie dieser Zukunft zu- (gut) oder abträglich (böse) sind. Das Motto ist „Grow or die“.
Mit der kaltschnäuzigen Selbstsicherheit von Sektengurus glauben die Tech-Milliardäre, die Menschheit in eine Zukunft kommandieren zu dürfen, die sie als Kind in Science-Fiction-Romanen gelesen haben und von der ihnen entgangen ist, dass sie als Warnung formuliert waren. Sie merken dabei nicht einmal, dass das genau sie zu den Bösewichten unserer heutigen Cyberpunk-Welt macht. Diese Menschen sind gefährlich.
Die Graphnahmen der KI
In dieser bereits unvorteilhaften Gemengelage kommt nun die generative KI ins Spiel und beschleunigt die Machtkonzentration noch mal enorm. Auch KI kann als Graphnahme verstanden werden, und sie wird alles in den Schatten stellen, was wir bisher gesehen haben. Genaugenommen handelt es sich um vier Graphnahmen, die uns jetzt drohen.
- Die Graphnahme der KI-Technologie
KI-Forschung war bis vor kurzem ein heterogenes Feld, das von Universitäten bis zu kleinen Startups ein vielfältiges Ökosystem bildete. Doch die Möglichkeit, mächtige KIs zu trainieren und bereitzustellen, ist direkt an die Verfügbarkeit von roher Rechenpower gekoppelt, die heute vor allem auf der Verfügbarkeit spezieller Grafikprozessoren basiert und um deren knappe Ressource ein regelrechter Verteilungskampf entbrannt ist. Die ökonomisch-materielle Eigenheit der Künstlichen Intelligenz konzentriert also alle Abhängigkeiten auf die Ebene der Infrastruktur, wo zig Millionen Grafikkarten in Serverclustern die riesigen Datenmengen durchwalten. Alleine dieser Umstand resultiert in einer Machtkonzentration, die selbst die der Plattformen in den Schatten stellt. Die Universitäten sind längst raus aus dem Spiel, und immer häufiger müssen auch die Startups das Handtuch werden. Wer nicht direkt verbandelt mit den digitalen Cloudanbietern wie Microsoft, Google und Amazon, hat keine Chance mehr, was Letzteren die monopolartige Kontrolle über diese Technologie in die Hände legt.
- Die Graphnahme des Internets
KI ist hier, um das Internet zu ersetzen. Die Graphnahme des Internets ist bereits im Gange und erfolgt in drei Schritten:
- Die Modelle wurden mehr oder weniger mit den Daten des Internets trainiert, urheberrechtlich geschützte Werke inklusive. Viele setzen nun ihre Hoffnung auf eine Handvoll noch laufende Urheberrechtsklagen, doch die historische Erfahrung mit den Plattformen zeigt, wie sie zunächst das Patentrecht und zunehmend das Urheberrecht für sich dazu nutzen, ihre Macht zu konsolidieren. Rechteabtretung ist am Ende eine Frage des Preises und Geld haben die Techfirmen genug. Eine Art, über die Modelle nachzudenken, ist, sie als eine hochkomprimierte Kopie des Internets zu betrachten.
- Startups wie Arc Browser oder Perplexity Search verweisen auf ein neues „Search“-Paradigma, bei dem man statt einer Link-Liste direkte Antworten bekommt, die die KI im Hintergrund recherchiert. Diese Antworten sind weniger reichhaltig als eine klassische Ergebnisliste, jedoch auch bequemer, und sie bedienen das Informationsbedürfnis viel direkter. Auch Google bewegt sich immer stärker in diese Richtung.
- Weil KI-Modelle weiterhin notorisch unzuverlässig sind, werden sie heute überproportional zur Produktion von Spam und Propaganda eingesetzt, denn da ist die Fehlerhaftigkeit des Outputs vergleichsweise egal. Das führt dazu, dass das Internet und die Social-Media-Plattformen gerade in einem Tsunami von Spam- und Fake-Websites und -Profilen ertrinken. Manche sprechen bereits davon, dass das Informationszeitalter vom Zeitalter des Rauschens abgelöst wurde.
Im Ergebnis führt das dazu, dass die Ersetzung des Internets als Ort der Informationssuche durch die ärmere KI-Variante dadurch abgesichert wird, dass der Weg zurück zum ursprünglichen Internet versperrt ist, weil die generativen KIs es in atemberaubendem Tempo unbrauchbar gemacht haben.
Schon der Machtzuwachs bei den Plattformen war davon getrieben, dass sie ständig Probleme generierten, die nur sie im Stande waren, zu lösen. Und mit KI beschleunigt sich dieser Prozess dramatisch und damit die Abhängigkeit der Weltgesellschaft von den Techriesen.
- Die Graphnahme der Sprache und unserer bildlichen Semantik
Die Millionen Texte und Bilder, mit denen die Modelle in der Trainingsphase gefüttert wurden, bilden die grundlegende Semantik unserer Kultur und Gesellschaft ab. GPTs und Diffusion-Modelle machen unsere Kultur nun statistisch operationalisierbar und damit in Annäherung reproduzierbar. Dabei funktionieren diese Modelle so, dass sie aus den Trainingsdaten einen tausenddimensionalen statistischen Vektorraum für alle Beziehungen und Metabeziehungen von Begriffen bzw. Formen extrahieren, der dann für die „Next Word Prediction“ oder Bildgenerierung genutzt werden kann. Mit anderen Worten: Die Modelle synthetisieren die kulturelle Semantik der Gesellschaft.
Werden diese Modelle aber nun von vielen Menschen im großen Maßstab genutzt, um Texte und Bilder halb- oder sogar ganz automatisiert zu erstellen und zu verbreiten, dann erlaubt das den Betreibern eine subtile Kontrolle über Sprache und Semantik. Mit der Kontrolle eines populären Sprachmodells verfügt man über eine Art Massen-Sprechakt-Waffe, mit der man eigene politische Framings, argumentative Figuren und Narrative im großen Maßstab in die generierten Texte und so in den Sprachgebrauch injizieren und so zu ihrer Normalisierung beitragen kann.
- Die Graphnahme der Demokratie
Die Transformation durch generative KI setzt sich bis in die Tiefe der gesellschaftlichen Abhängigkeitsstrukturen fort. Schon jetzt sinken die Abhängigkeiten beispielsweise gegenüber den Leistungen von Übersetzern, Grafikern, Programmierern und Textern, und mit zunehmender Mächtigkeit der Modelle werden immer mehr Kompetenzen und Berufsfelder ihre Verhandlungsmacht einbüßen. Nimmt man die Ziele und Prognosen der KI-Unternehmen ernst, dann muss man davon ausgehen, dass sich die arbeitsteilige, funktional differenzierte Gesellschaft in den nächsten Jahren komplett entflechten wird. In der Öffentlichkeit wird in dieser Hinsicht immer nur von den möglichen oder tatsächlichen Arbeitsplatzverlusten geredet – es wird aber nicht thematisiert, dass diese reduzierten Abhängigkeiten durch eine entsprechend erhöhte Abhängigkeit von den Tech-Unternehmen erkauft wird. Alle Macht, so scheint es, konzentriert sich gerade im Silicon Valley.
Innerhalb des Frameworks von Mesquita und Smith ergibt dieses Handeln sowohl für Arbeitgeber als auch für die KI-Unternehmen absolut Sinn: Hier werden breite und vielfältige Abhängigkeiten von Vielen durch eine konzentrierte Abhängigkeit von Wenigen ersetzt, was beiden Akteuren ihre Macht sichert und einfacher managebar macht. Es ist wie eine Verschwörung der KI-Unternehmen mit den Kapitalisten weltweit, um den Menschen aus allen Abhängigkeitsgleichungen zu streichen und ihn so endgültig zu einer macht- und einflusslosen Verschiebemasse zu machen (nominelles Selektorat). Adieu freies Internet. Adieu lebendige, dezentrale Semantik. Adieu komplexe, arbeitsteilige Gesellschaft. Adieu Demokratie.
Der Aufstand?
All das, was ich hier beschrieben habe, wirkt für die meisten Menschen noch fern und abstrakt. Würden sie begreifen, was gerade in atemberaubendem Tempo passiert und wie sich das auf ihre Stellung in der Gesellschaft auswirken wird, würden sie in Massen auf die Straßen strömen.
Vielleicht werden sie das auch noch tun, sobald die Auswirkungen für sie spürbar werden. Noch haben die meisten Menschen, die diese Umwälzung betrifft, vergleichsweise mächtige gesellschaftliche Hebel. Und mit dem Streik der Drehbuchautoren in Hollywood gibt es bereits ein Beispiel, an dem man sich orientieren kann. Ich kann mir durchaus eine weltweite Protestbewegung gegen KI vorstellen. Boykottmaßnahmen, Massendemonstrationen, politischer Druck auf Wirtschaft und Politik, die Systeme zu meiden, zu regulieren oder gar zu verbieten. Ich würde das durchaus begrüßen, aber ich fürchte, eine solche Stoßrichtung wird im Sand verlaufen.
Ich bin skeptisch, dass es gelingen kann, eine offensichtlich so brauchbare Technologie, die bereits jetzt zu einem Großteil als Open Source weiterentwickelt wird, wirksam zu verbieten. Ich glaube deswegen, dass es sinnvoller ist, die Machtstrukturen direkt anzugehen. Von Mesquita und Smith können wir lernen, wie die Konzentration von Macht in der Gesellschaft diese für die Machtergreifung von Autokraten anfällig macht und dass das beste Mittel dagegen ist, die Abhängigkeiten wieder zu dezentrieren.
Das stellt uns nicht nur vor die schwierige Aufgabe, das Silicon Valley zu entmachten und die KI-Systeme unter demokratische Kontrolle zu stellen. Die eigentliche Mammutaufgabe ist, die Gesellschaft wieder so zu organisieren, dass sich die ökonomisch-materiellen Abhängigkeiten weitläufig und kleinteilig über die Menschen verteilen. Und wir haben leider auch nicht den Luxus, auf die dafür zu entwickelnden Gesellschaftsutopien zu warten. Wir müssen jetzt handeln.
Strategisch scheint mir deswegen eine Konzentration nicht auf die Technologie, sondern auf die Ungleichheit am effektivsten. Das herausragendste Symptom der Ungleichheit ist die Existenz von Milliardären. Es braucht ein weltweites Bewusstsein für die Gefahr, die von diesen Menschen für Demokratie und Menschenrechte ausgeht. Die Existenz von Milliardären muss als Politikversagen verstanden werden, und es muss zu einer weltweiten Bewegung kommen, die die Gesellschaft wieder aus den Händen dieser Leute befreit.
Ich gebe zu, dass ich auch hier pessimistisch bin. Im derzeit noch hegemonialen neoliberalen Paradigma gelten Milliardäre lediglich als besonders erfolgreiche Individuen, denen man ihren Reichtum doch einfach gönnen sollte. Es wird nicht gesehen, wie diese Menschen längst das politische Heft in die Hand genommen haben und die Demokratie ihnen bereits vielerorts ausgeliefert ist. Es wird zudem nicht gesehen, wie sich die Machtakkumulation an der Spitze der Gesellschaft gerade enorm beschleunigt, so dass auch unsere Chancen mit jedem Tag schwinden, ihrem Machthunger Grenzen zu setzen können.
Deswegen wäre eine weitere Hoffnung, dass es irgendwie gelingt, die Befürchtungen, die ich in diesem Text so abstrakt und theoretisch formuliert habe, in publikumswirksamere Narrative zu übersetzen, um ein Bewusstsein für diesen gerade stattfindenden Coup in die Breite der Gesellschaft zu tragen





Pingback: Etwas zur KI-Problematik und der Netzentwicklung – netbib
Pingback: Krasse Links No 17. | H I E R
Pingback: KI Demokratie - Christian Pohl - Lehrer und Sprecher
Pingback: Zeitfaktor und KI: Die unterschätzte Dringlichkeit • horst schulte
Pingback: Extern: MATERIALITÄT UND AUSTAUSCHBARKEIT. | ctrl+verlust
Pingback: Krasse Links No 26 | H I E R
Pingback: Krasse Links No 30 | H I E R
Pingback: Krasse Links No 42 | H I E R
Pingback: Krasse Links No 43 | H I E R